|
A. Das falsche Lob der
Mathematik
Durch die Verwendung von
Mathematik soll ein Ding namens „exakte Wissenschaft“
zustande kommen. Bloß: Was ist eine exakte Wissenschaft? An und für
sich eine pure Tautologie. Genauso wie „weißer Schimmel“ oder „alter
Greis“. Denn Wissenschaft besteht darin, gerade die Bestimmungen
einer Sache zu erschließen und in Urteile zu fassen, die ihr
und nicht irgend etwas anderem zukommen.
Deshalb erfährt man auch nie, was
denn eine Wissenschaft wäre, die nicht exakt vorginge, und was sie
insofern für Fehler machte. Statt dessen bekommt man jede Menge
Vorteile des Gebrauchs der Mathematik aufgezählt:
l. Zahlen sind genau
Ebenso oft sind sie natürlich
ungenau. Bekannte Frage: Wie viele Stellen nach dem Komma sollen es
denn sein? Genauigkeit ist keine den Zahlen immanente
Eigenschaft, sondern eine an sie genauso wie an andere Bestimmungen
einer Sache zu stellende Forderung.
Beispiel:
I. Freifallende Körper erfahren
eine Beschleunigung von 9,8l m/s2.
II. Demokratien sind
Rechtsstaaten.
Das zweite Beispiel haben wir
natürlich heimtückischer Weise so gewählt, dass keiner die Wahrheit
dieses Urteils bestreiten wird. Aber selbst wenn dem so wäre: dann
würde so ein Zweifler gerade genau wissen, was wir gesagt haben und
er nicht für richtig hält.
Irgendein Unterschied in der
Genauigkeit beider Aussagen ist offenbar nicht zu entdecken. Mehr
noch: jeder Versuch, Aussage II durch Zahlen präziser und schärfer
zu machen, ist albern, geht völlig an der Sache vorbei. Was wollte
man denn hier zählen? Gesetze, Polizisten, Gerichtsverfahren,
Strafgefangene? Davon gibt es in „Unrechtsregimes“ genauso viel. Und
um den Vergleich vollständig zu machen, stelle man sich einmal vor,
was in beiden Sachgebieten eine ungenaue Aussage wäre:
I. Die Beschleunigung ist ziemlich
groß.
II. In der Türkei gibt es wieder
beinahe rechtsstaatliche Verhältnisse.
In beiden Fällen weiß man nicht,
woran man ist; das wird zur Standpunktfrage. Bei I. wird das in der
Natur der hier gegebenen Bestimmung (groß) liegende Bedürfnis nach
Zahlenwerten nicht befriedigt. Es wird von Größe geredet, aber diese
nicht angegeben. Bei II. wird eine Bestimmung angegeben, von der
zugleich gesagt wird, dass sie nicht zutrifft. Genauso gut könnte
man sagen: In der Türkei herrscht keine ordentliche Diktatur mehr.
2. Zahlen sind objektiv
Hier können wir nur unsere
Argumentation von oben wiederholen. Es ist nicht zu sehen, wieso II.
weniger objektiv als I. sein soll, oder wie man II. objektiver
machen könnte. Schlaumeier werden aber vielleicht noch einwenden,
dass sich Zahlen immerhin objektiv ermitteln lassen.
„Objektiv“ soll hier also heißen, dass es Messapparaturen und
-verfahren gibt, die ganz unabhängig von den Wünschen und
Meinungen der Subjekte die in Frage stehenden Größen feststellen,
während eine ähnlich Vertrauen erweckende „übersubjektive“ Prozedur
für „qualitative“ Aussagen nicht zur Verfügung stehe. Bloß: Eben
waren doch noch alle einig, dass Demokratien Rechtsstaaten sind, und
das ganz ohne Messgeräte. Und, noch viel wichtiger: Wenn man
irgendeine Größe messen will, sagen wir die Temperatur, muss man
doch zuallererst wissen, um was es überhaupt geht. Denn das ist
nicht möglich: objektive Zahlen für die Temperatur gewinnen und es
für sehr subjektiv halten, was eine Temperatur ist, ob
eine solche vorliegt, wie sie erfasst werden kann etc. Man braucht
eine ganze Theorie, bevor man Thermometer bauen kann. Der Blödsinn
dieser Vorstellung ist also, dass man seinem Verstand weniger trauen
möchte als einem technischen Gerät, das als Hilfsmittel der
Erkenntnis fungiert. Bloß: Dieses Gerät selbst, genau wie sein
zweckmäßiger Gebrauch, ist eine Leistung des Verstandes. Das ist
bekanntlich der Unterschied zwischen Messgerät und Wünschelrute.
3. Die Sprache der Mathematik
ist eindeutig
Bekanntlich versteht sie deshalb
auch kein Schwein. Wenn irgendwo im Mathematikbuch steht
d/dx
tan x = 1/ cos2x ;
dann ist das dasselbe wie der gute
deutsche Satz
„die erste Ableitung der
Tangensfunktion ist gleich dem Kehrwert des Quadrats der
Cosinusfunktion.“
Weil beide Versionen haargenau
dasselbe besagen, ist keine eindeutiger als die andere.
Der Gebrauch von Symbolen schafft nicht die Eindeutigkeit von
Begriffen und Gedanken, sondern setzt sie voraus; um eine
Notation wie d/dx sinnvoll gebrauchen zu können, muss ich wissen,
was die Ableitung einer Funktion ist. Und wenn ich davon keine
Ahnung oder nur nebelhafte Vorstellungen habe, hilft mir das Symbol
nicht weiter. Das ist in der Mathematik nicht anders als im
wirklichen Leben. Man denke z.B. an die Verkehrszeichen: Wer nicht
weiß, was „anhalten und warten“ ist, kann mit dem Rotlicht einer
Ampel nichts anfangen. Man denke auch an den üppigen Gebrauch von
Symbolen in Pseudowissenschaften: Astrologie, Alchimie, Magie: Hier
sind Symbole Vehikel der Scharlatanerie.
Eine ganz andere Frage ist
es, dass man seine Gedanken durch die Sprache, aber auch durch
Symbole, unvollkommen, etwa mehrdeutig ausdrücken kann. Dann muss
eben zurückgefragt werden, ein paar zusätzliche Sätze sind fällig
etc. Alle Beispiele dafür, wie man durch den Gebrauch der Sprache in
die Irre geführt werden kann („Der Herr traf die Dame mit dem
Regenschirm.“), belegen gerade nicht, wie sie wollen, einen
grundsätzlichen Mangel der Sprache. Um dem Leser mitzuteilen, was
das Missverständnis ist, muss ihm nämlich auch noch schnell das
richtige Verständnis mitgeteilt werden; und siehe da: Das ist
machbar! Im übrigen sollten sich die Freunde der mathematischen
Symbolsprache mal folgendes vor Augen halten. Es gibt kaum ein
Symbol, das so viele verschiedene Bedeutungen hat wie das x der
Mathematiker. In jedem Kapitel eines Buchs, in jedem Buch eine
andere. Sogar in der oben genannten Formel wird x in zweifachem Sinn
verwendet: In Ausdrücken wie tan x kann ich Zahlen für x einsetzen,
z.B. tan 0. Aber dies kann ich bei dx gerade nicht tun, und deshalb
auch nicht bei dem Gesamtausdruck.
Zusatz: Dass Mathematiker
Symbole benutzen, hat praktische Gründe. Diese sind bequemer
zu benutzen als die entsprechenden Wortungetüme, und wenn
Mathematiker sich etwas zu sagen haben, dann Stellen sie sich vor
eine Tafel. Dass sie überhaupt so komplizierte Ausdrücke brauchen,
kommt daher, dass sie mit ihren Gegenständen operieren müssen
Bildung des Kehrwerts, des Quadrats etc. Und solches Operieren lässt
sich eben sehr gut durch das Zusammenstellen von Symbolen zu einer
Formel ausdrücken; man kann damit dann auch gleich rechnen. Dasselbe
gilt übrigens für die Formeln der Chemie.
4. Die Mathematik ist logisch
Dass in der Mathematik keine
Fehlschlüsse vorkommen können, wird wohl niemand behaupten, der sich
einmal ernsthaft um die Materie bemüht hat. Wenigstens an seinen
eigenen Bemühungen gewinnt er ganz schnell Beispiele dafür, wie
leicht man auch hier Fehler machen kann. Und die Geschichte der
Mathematik ist voll davon. Eine andere Sache ist es, dass
Mathematiker sehr viel Wert darauf legen, dass ihre Sachen stimmen;
insbesondere lassen sie nichts ohne Beweis
durchgehen. Aber bitteschön: Was sollte denn andere Wissenschaften
davon abhalten, auf ihrem Gebiet ebenfalls auf richtigen Schlüssen
und Beweisen zu bestehen? Und im übrigen sind diese Dinge noch nicht
einmal Spezifika der Wissenschaft, sondern an der Tagesordnung, seit
die Menschheit das Neandertal verlassen hat. Schon die Kinder
wissen, wann etwas „logo“ ist. Gemeint ist mit diesem Lob der
Mathematik wieder eine ziemlich krumme Vorstellung. Nämlich dass
sich die Argumente der Mathematiker
überprüfen ließen, und zwar
nicht so, dass man sie
nachvollzieht,
also mitdenkt.
Sondern so, dass man die Richtigkeit eines Beweises feststellen
könne, ohne sich auf seinen Inhalt einzulassen: ganz „formal“, und
daher „objektiv“. Das geht weder in der Mathematik noch sonstwo.
Denn was da verlangt wird, ist ein Widerspruch: man soll
richtig denken, ohne
etwas zu denken, also
ohne überhaupt zu
denken.
Formale Richtigkeit - ein
Unsinn
Die Vorstellung, dass dieses
falsche Ideal formaler Richtigkeit wenigstens in der Mathematik
praktiziert werden könne, pflegt sich auf einen weiteren Unsinn zu
berufen. Nämlich dass die Mathematik keine Gegenstände und Inhalte
habe. Bloß: Womit befassen sich denn die Mathematiker dauernd? Die
Theorie der Differentialgleichungen zum Beispiel befasst sich mit
den Differentialgleichungen. Was denn sonst! Und dass
Differentialgleichungen keine Kohlköpfe sind und keine politischen
Systeme, heißt noch lange nicht, dass sie nichts wären; sie sind
eben etwas anderes. Und wenn jetzt einer wissen will, was es mit
diesen Differentialgleichungen auf sich hat können wir ihm bloß
raten, die einschlägige Theorie zu studieren.
Wissenschaftliche Willkür feiert
die Mathematik als ihr Hilfsmittel
Die Gründe, die für den Gebrauch
der Mathematik angeführt worden sind, sind samt und sonders nicht
stichhaltig. Ihnen gemeinsam ist der Wunsch. in der Mathematik ein
Mittel zu haben, das anständige wissenschaftliche Ergebnisse
garantiert, also von sich aus und automatisch dafür sorgt,
dass richtige Urteile zustande kommen und Fehlschlüsse vermieden
werden. Bloß: Wenn man richtige Ergebnisse haben will, ist es doch
überhaupt nicht klar, ob die Mathematik dabei im konkreten Fall auch
nur die geringste Hilfestellung bietet. „Richtig“ heißt doch,
wir sprachen eingangs schon davon, dass die Ergebnisse tatsächlich
Bestimmungen der untersuchten Sache sind, dass sie zutreffen,
also spezifisch sind. Und warum sollte eine x-beliebige Sache
ausgerechnet mathematische Bestimmungen haben? Umgekehrt: Wenn ein
Wissenschaftler sich - beispielsweise aus den oben betrachteten
Gründen - dazu entschließt, auf seinen Forschungsgegenstand mit
mathematischen Methoden loszugehen, dann leistet er sich ein
Vorurteil. Denn diese Wahl der Methode begründet sich nicht aus
seiner Kenntnis der Sache, sondern soll ihm, wie er selbst
versichert, erst zu solchen Erkenntnissen verhelfen. Er fängt also
die Wissenschaft damit an, dass er festlegt, wie seine
Resultate aussehen sollen - und das ausgerechnet zu dem
Zweck, solche Ergebnisse erst zu kriegen.
Die Mathematik wird auf diese
Weise das Gegenteil von dem, was sie angeblich ist. Sie dient nicht
als Instrument größerer Exaktheit, sondern als ein Medium, in dem
der Forscher ausdrückt, wie er die betrachteten Gegenstände sehen
will. Am Anfang steht so die Willkür: Sowenig es klar sein
kann, dass sich der Untersuchungsgegenstand überhaupt
mathematisch erfassen lässt, sowenig ist klar, was für
mathematische Qualitäten ihm im einzelnen zugeschrieben werden
können. Das ist also eine Frage des Interesses eines solchen
Wissenschaftlers; er entscheidet, dass und wie er eine Sache als
Größe, als Funktion usw. sehen will. Die Objektivität der
Wissenschaft ist somit beim Teufel, bevor sie überhaupt angefangen
hat. Und was dann nach solchen Ansätzen kommt, macht die
Gesamtveranstaltung auch nicht besser: Da beschäftigt man sich
fleißig mit dem Material, um seine sehr subjektiven
Ausgangsvorstellungen mit Leben zu erfüllen.
Übrigens: Hartgesottene Vertreter
dieser Willkür in der Wissenschaft wollen die Sache mit der
Exaktheit dann auch lieber sehr viel enger verstanden wissen. Die
Mathematik soll diesen Skeptikern zufolge nicht mehr zur Richtigkeit
der Theorie beitragen, sondern lediglich helfen, die Hypothesen, die
man sich frei und nach Belieben ausdenkt, „stimmig“ und „wasserdicht“
zu formulieren. Diese Vorstellung grenzt nun aber wirklich schon an
Idiotie: Richtig sollen die eigenen Gedankenkonstrukte nicht sein,
aber in sich stimmig. Im Ernst: Warum machen solche Freunde
subjektiver Geistesfrüchte nicht die Auflage, dass dieselben in
Gedichtform, in Hexametern oder sonstwie streng geregelt in die Welt
gesetzt werden?
Im Folgenden soll an drei
Beispielen gezeigt werden, was für unwissenschaftliche
Betrachtungsweisen Volkswirte produzieren, wenn sie sich so ganz
exakt ans Werk machen. Dabei wird sich auch ein Einwand von selbst
erledigen, den mancher Leser vielleicht jetzt noch hat. Der Einwand
nämlich, dass mit dem Entschluss zur Mathematik noch „nicht viel“
gesagt sei. Diesbezüglich sei vorerst nur an zweierlei erinnert.
Erstens soll nach allgemeiner Meinung doch mit der Mathematik
„furchtbar viel entschieden sein, nämlich der wissenschaftliche
Charakter der ganzen Veranstaltung. Und zweitens ist es eben einfach
nicht wahr, dass die Mathematik „nichts“ ist. Sie handelt zum
Beispiel von Quantitäten und deren Gesetzen, und unser erstes
Beispiel wird gleich zeigen, wie sehr man die Welt und seinen
eigenen Verstand vergewaltigen muss, um ökonomische Größen zu
entdecken, die gar nicht da sind.
B. Drei Beispiele
Beispiel l: Das Sozialprodukt
oder die Wirtschaft als Zahl
Das Sozialprodukt kennt heute
jeder; es steht mindestens so oft in der Zeitung wie der
Bundeskanzler. Denn es handelt sich um die „wichtigste Kennziffer
des Wirtschaftsgeschehens“.
Bloß: Wieso soll es denn überhaupt
eine Größe geben, die ausdrückt und zusammenfasst, was
wirtschaftlich los war während eines Jahres die also die Ökonomie
insgesamt zu charakterisieren imstande ist. Auch wenn es bei
mancherlei technischen Dingen - vom Wechselstrom bis zur
Benzinqualität - solche Kennziffern gibt, ist deren Existenz keine
Selbstverständlichkeit, die überall zuträfe. Schließlich gibt es
auch keine Zahlen, die überzeugend auszudrücken vermöchten, wie etwa
die weltpolitische Situation oder der Geisteszustand der Menschheit
beschaffen ist.
Wie kommt also ein Ökonom auf die
gewünschte wirtschaftliche Kennziffer? Leider so, dass ihm der
Wunsch als Vater aller weiteren Gedanken völlig ausreicht. Hier wird
also nicht die Wirtschaft analysiert und dabei eine Größe entdeckt,
auf die es wesentlich ankommt. Sondern hier wird umgekehrt und sehr
willkürlich ein Gesichtspunkt konstruiert, der die
angestrebte Quantifizierung zu liefern verspricht.
„Wir betrachten die gesamte
Volkswirtschaft - modellhaft vereinfacht - als eine einzige
Riesenunternehmung, die durch einen Kasten dargestellt wird, von
dem wir zunächst nicht wissen (wollen) was in seinem Inneren vor
sich geht. Auf der einen Seite geht ein Input ein und auf der
anderen Seite kommt in einer Periode (zum Beispiel in einem
Jahr) durch die Produktion m der Riesenunternehmung
Volkswirtschaft ein Output heraus. Hinsichtlich des Output
nehmen wir zunächst in extremster Abstraktion an, dass nur ein
einziges Universalgut hergestellt wird, das sich für alle
denkbaren Verwendungszwecke gleich gut eignet. Wir wollen das
Gut Sozialprodukt nennen.“ (Bartling-Luzius, 22)
Gegen diese Definition des
Sozialprodukts ist nun nicht einzuwenden, dass die Realität zu sehr
„vereinfacht“ und in diesem Sinne "abstrakt" dargestellt wird.
Sondern dass hier zu einem ganz verkehrten Gedanken
aufgefordert wird. Man soll sich eine Vorstellung von der Wirtschaft
machen - aber ausdrücklich ohne etwas von ihr wissen zu wollen.
Drastischer kann man die Unwissenschaftlichkeit dieses `Vorhabens
nicht charakterisieren. Aber weil das so schlecht geht - sich eine
Wirtschaft zurechtphantasieren, aber immerhin noch eine
Wirtschaft -, wird explizit angegeben, wo man lügen muss Man
soll so tun, als ob ein Universalgut hergestellt würde. Man soll
also das was zu beweisen wäre, nämlich dass die Wirtschaft eine
einheitliche und insofern bezifferbare Leistung hat, einfach mal
voraussetzen, und das sogar trotz eingestandenen Widerspruchs
zur Realität.
Man sieht hier, wie das Ideal
mathematischer Exaktheit die Ökonomen dazu treibt, sich höchst
unexakte Gedanken zu machen. Der Einfall, die Wirtschaft in eine
Zahl zusammenzufassen, hat die Ökonomen auf den Blödsinn eines
Universalgutes gebracht, und dieses Universalgut wird sie jetzt
zu weiteren drolligen Bocksprüngen veranlassen. Denn die Frage,
wieviel Universalgut alias Sozialprodukt herauskommt, ist ja eben
deshalb alles andere als leicht zu beantworten, als dieses schöne
Universalgut ganz gewiss weder von VW noch von Maggi produziert
wird.
Die übliche Ausflucht ist nun,
einfach jedes Gut, es mag sein, was es will, als ein Stück
Universalgut zu betrachten. Das Sozialprodukt „stellt die
Summe aller Güter und Dienstleistungen dar“ (Henrichsmeyer,
247). Nun bringt diese glückliche Antwort auf die Existenzfrage
des Sozialprodukts - einfach festzulegen, dass alle Güter und
Dienstleistungen zusammen dieses Universalgut darstellen - wieder
die allergrößten Probleme mit sich:
Problem Nr. 1 ist, wie es
so schön heißt, technischer Natur.
„Will man zu Gesamtgrößen
für eine Volkswirtschaft gelangen, so versagt das Verfahren, mit
Hilfe physischer Mengeneinheiten zu messen, völlig. Es muss dann
eine allen Gütern gemeinsame, Messbare und additive Eigenschaft
gefunden werden.“ (Stobbe, 285)
Man kann nicht Apfel und Birnen,
Haarschnitte und Beerdigungen einfach zusammenzählen, um eine runde
Summe zu erhalten. Hier wirkt sich die mathematische Exaktheit
leider sehr störend aus. Zwar liefert sie einem die Vorstellung
einer Summe (gut!), aber leider auch ein paar Rechenregeln
dazu (schlecht). (Wir erinnern hier an die gutwillige Meinung,
dass mit der Übernahme mathematischer „Denkformen“ noch
„nichts entschieden“ wäre. Eben doch! Um den ganzen Plunder, der in
der Ökonomie vorkommt, unter die Vorstellung einer mathematischen
Summe zu subsumieren, müssen, eben weil eine Summe auch etwas
Bestimmtes ist und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat, schon noch
ein paar Anpassungen vorgenommen werden.)
Problem Nr. 2 ist die heiße
Frage, was alles in diesen Summationsprozess eingehen kann und
darf.
Gerade weil die Wirtschaft weder
eine Riesenunternehmung noch überhaupt ein schwarzer Kasten ist, ist
völlig offen, was man als ihren Output ansehen soll. Gehören Apfel
und Birnen dazu? Klar. Haarschnitte und Beerdigungen? Dito. Aber wie
steht es mit Herbstmanövern und Bundestagsreden? Oder was ist mit
Teach-ins oder Flugblättern der MG? Sicherlich alles „produzierte“
Dinge und sicherlich auch alles „nützlich“, zumindest in den Augen
dessen, der sie produziert. Angesichts dieser doppelten
Schwierigkeit entschließt sich die wissenschaftliche Ökonomie - und
hier handelt es sich wirklich um einen Entschluss, um eine durch
kein einziges sachliches Argument zu stützende Festlegung -, die
Lösung wiederum mithilfe des Ideals mathematischer Exaktheit
zu finden. Zahlen will man haben, und deshalb nimmt man
einfach, was an Zahlen ohnehin existiert. Nämlich die Preise von
Gütern und Dienstleistungen.
„Statt solcher technischen
Attribute (Pfund Äpfel; Stück Beerdigung) verwendet man als die
gesuchte Eigenschaft trotz aller damit verbundenen Nachteile die
Marktpreise der Waren.“ (Stobbe, 285)
Das ist zwar nicht logisch, aber
konsequent. Denn die Frage nach der zu messenden Qualität -
also Bestandteil des gesamtwirtschaftlichen Outputs zu sein - wird
hier ersetzt durch ein Messverfahren, das als einzigen
Vorteil haben soll, durchführbar zu sein. Alles, was einen Preis
hat, ist eben dadurch auch schon als Bestandteil des Sozialprodukts
qualifiziert. Und das erledigt ganz en passant auch Problem Nr. l.
Als Preise sind natürlich alle Güter aufsummierbar. Weil aber Preise
nicht dazu gemacht werden, einem Ökonomen die Bildung des
Sozialprodukts zu erleichtern - Preise sind eine praktische
Angelegenheit, über sie macht der Warenbesitzer seinen Gewinn
-, zeitigt diese saubere Lösung gleich eine Latte neuer Probleme.
Zum Beispiel: Es gibt Dinge, die, weil nicht für Verkauf und Gewinn
bestimmt, keinen Preis haben, aber von Ökonomen gern
eingeschlossen würden, weil sie nach landläufiger Meinung mindestens
so wertvoll sind wie alles was für Mark und Pfennig feilgehalten
wird. Da gibt es das segensreiche Wirken des Staates, von den
Autobahnen und Schulen bis zu den weniger fasslichen Gütern der
Sicherheit oder der Ordnung. Oder da gibt es die tüchtige Hausfrau,
die die Waschmaschine bedient, Äpfel im eigenen Garten erntet und
jede Menge Mutterliebe verstreut. Zum Beispiel: Dass sich Preise
verändern - und zwar ganz einfach deshalb, weil das Geld
Gegenstand ökonomischer Interessen und kein Messgerät der
Forschung ist -, ist dem Ökonomen Anlass zur Frage, ob denn die auf
dem Markt anzutreffenden Preise wirklich wiedergeben, mit welchem
Gewicht ein Produkt dem Sozialprodukt einzugliedern ist. Soll man
die aktuellen Preise nehmen, oder sind die von l955 richtiger? Und
wie berücksichtigt man, dass seitdem die Milch dünner und die Autos
dicker geworden sind?
Zusammenfassung:
Das Streben nach mathematischer
Exaktheit führt zu allergrößter Konfusion, Willkür und Streit. Und
das eben deshalb, weil dieses methodische Ideal das Gegenteil einer
anständigen wissenschaftlichen Befassung mit den Gegenständen ist.
All die Sorgen um Messbarkeit, richtige Preise, statistische
Prozeduren etc. bringen einen Ökonomen nie auf den einfachen
Gedanken, dass er vielleicht etwas Falsches, eine nicht existente
Größe zu ermitteln sucht. Vielmehr sieht er sich bestätigt darin,
dass es eben nicht leicht sei, aber umso wichtiger, sich um
Genauigkeit zu bemühen. Ganz unangezweifelt und eher noch bestärkt
geht deshalb die ideologische Botschaft,
der Inhalt des ganzen Rechenwerks, aus solchen Schwierigkeiten
hervor. Die Botschaft nämlich, dass die Wirtschaft insgesamt genauso
zu betrachten sei wie irgendein Produktionsprozess, den einer
unternimmt, damit hinterher ein Produkt herauskommt.
Dieses falsche Dogma von der
Wirtschaft als ertragbringender Veranstaltung erhält Glaubwürdigkeit
dadurch, dass man es mathematisch fasst, also sich bemüht, die Größe
des fiktiven Ertrags möglichst exakt auszurechnen.
Und angesichts dieser
hochwissenschaftlichen Lüge gilt die schlichte Wahrheit als
unwissenschaftlich, dass nämlich die Wirtschaft keine
Gemeinschaftsveranstaltung ist, sondern sich durch Konkurrenz
auszeichnet, und dass ihre Leistungen in dicken Profiten und
massenhaftem Elend bestehen.
Beispiel 2: Die
Einnahmen-/Ausgaben-Analyse oder die Wirtschaft als Punkt und Kurve
Am Beispiel des Sozialprodukts
haben wir jetzt gesehen, wie der Makroökonom fiktive Größen
in die Welt setzt. Genauso wie er sich beim Sozialprodukt vorstellt,
dass die Wirtschaft insgesamt ein Ergebnis habe, so stellt er
sich nun unter den Titeln gesamtwirtschaftliches Einkommen (Y) und
gesamtwirtschaftliche Ausgaben (A) vor, dass die Wirtschaft
insgesamt - so wie jeder Arbeiter, Kapitalist, Rentenempfänger - ein
Einkommen und daraus zu tätigende Ausgaben habe. Zwischen diesen
beiden Größen Y und A möchte er als nächstes eine
Funktionsbeziehung entdecken. Die Verwandlung der Wirtschaft in
ein Fabelreich von Größen, die als gesamtwirtschaftliche an keiner
Stelle im Wirtschaftsprozess eine Rolle spielen können, ergänzt er
um das Programm, eben diese Abstraktionen mit eigenem Leben
zu erfüllen: nämlich sie als solche aufeinander einwirken
oder voneinander abhängen zu lassen. Er möchte z.B. jetzt das
gesamtwirtschaftliche Einkommen zum Grund dafür machen, dass die
gesamtwirtschaftlichen Ausgaben so und so hoch sind:
„Die Formulierung solcher
Hypothesen in der Form mathematischer Gleichungen nennt man
Verhaltensgleichungen. Sie schildern die verhaltensbedingte
Abhängigkeit der Zielgrößen von den jeweiligen Determinanten.“
(Münnich, 26)
Um sein wissenschaftliches Ziel,
die eine makroökonomische Größe als durch die andere bestimmt
darzustellen, plausibel zu machen, lässt er sich das Verhalten
der Leute einfallen. Das ist schon komisch: Denn wie sollte sich
irgendein lumpiges Wirtschaftssubjekt zu solchen Abstrakta
wie Volkseinkommen und gesamtwirtschaftliche Ausgaben verhalten?
Aber noch schlimmer: „Verhaltensbedingte Abhängigkeit des A von
der Determinante Y“ heißt das widersprüchliche Programm. Hier
müsste sich der Ökonom logischerweise entscheiden: Entweder ist das
Verhalten der Leute dafür verantwortlich, was los ist auf der Welt,
oder die eine Größe für die andere. Entweder ist das
Wirtschaftssubjekt mit seinem Verhalten entscheidend für die
Volksausgaben A. Oder die Ausgaben A sind bestimmt durch das
Einkommen Y; dann ist das Wirtschaftssubjekt mit seinem Verhalten zu
den Zielgrößen als bedeutungslos erklärt für den Zusammenhang von A
und Y.
Schon die Bezeichnung „Verhalten“
ist verkehrt, die ganz davon absieht, dass und zu welchem Zweck
die Leute für Lohn arbeiten, Sparren, Gewinne machen, Geld anlegen
etc. Auf diese selbstgeschaffene Inhaltslosigkeit kommt es
dem Ökonomen aber offensichtlich an. Er benutzt das Verhalten als
Appellationsinstanz: Er will die Ausgaben A als Funktion des
Einkommens Y darstellen. Aber weil er für diesen Zusammenhang auch
nicht die Spur eines Arguments hat, eröffnet er mit dem Hinweis auf
das Verhalten der Leute eine Möglichkeit, sich bei dieser Funktion
etwas zu denken. Irgendwie, soll man sich vorstellen, könnte
es ja sein, dass die Leute dafür sorgen, dass aus dem Y ein A wird -
wenn schon das Y selber kaum etwas bewegen kann. Und mit demselben
Irgendwie ist auch für jeden die Brücke zu seinen eigenen
alltäglichen Aktionen geschlagen: Wenn bei Muttern daheim Einnahmen
und Ausgaben zusammenhängen, wird's in der großen Welt wohl ähnlich
sein.
„Die Höhe der Ausgaben ...
hängt von der Höhe des Einkommens ... ab.... Die
gesamtwirtschaftliche Ausgabenfunktion lautet daher A(t) =
A(Y(t)).“ (Münnich,101)
Wir bemerken am Rande, dass die
Sache mit dem Verhalten jetzt erst mal wieder rum ist. Die
Wirtschaftssubjekte haben ihre Schuldigkeit getan. Ab jetzt hat die
Mathematik das Wort, und der Gebrauch von deren Symbolik
stiftet mindestens soviel Vertrauen wie der Appell an das
ungebildete Vorstellungsvermögen.
Schöpfung einer Funktion aus dem
Nichts
Weil die Welt, zu der sich der
Ökonom emporgearbeitet hat, aus Größen
besteht, ist die Inkarnation des Abhängigkeitsgedankens eine
mathematische Funktion. Eine solche schreibt er an - oder?
Mitnichten. Was hier mit A = A(Y) notiert wird, ist nicht
eine bestimmte Funktion. Die Buchstaben stehen nicht wie
sonst in der Mathematik für etwas wohl Definiertes, beispielsweise
einen Rechenausdruck, der den Zusammenhang zwischen den Größen A und
Y tatsächlich angeben würde. Die Symbole, so solide und für den
Laien ehrfurchtsheischend sie auch aussehen mögen, stehen dafür,
dass der hierher gehörige Rechenausdruck erst noch gefunden werden
muss: Was diese Zeichen bezeichnen, weiß noch kein Mensch -
und trotzdem stehen sie da.
„Die Art der Beziehungen,
die auf der allgemeinen Schreibweise der Gleichung nicht
ersichtlich ist, muss im konkreten Fall genauer angegeben (oder
spezifiziert) werden.“ (Stobbe, 5)
Die Frage, welche Funktion
die Funktion A(t) = A(Y(t)) eigentlich sein soll, zeigt, dass er mit
letzterer nicht ein Gesetz der Realität ermittelt hat, sondern
Gesetzmäßigkeiten konstruiert nach dem aberwitzigen Prinzip:
Erst denke ich mir eine Sache aus -,das Verhalten der
Wirtschaftssubjekte ist (irgend)eine Funktion' -, und dann
denke ich mir auch noch aus, um welche es sich dabei handeln
soll. Schon drollig, wie der Ökonom diese Verdrehung selbst
kommentiert: „Allgemein“ nennt er den Vorsatz, den Größen
einen Zusammenhang zu verpassen, und die Forderung nach „Konkretheit“
steht dann dafür, sich die Ausgestaltung vorzubehalten. Das geht
z.B. so:
„Wenn wir aber sowieso eine
solche Stilisierung A vornehmen müssen, dann ist es zweckmäßig,
diese so einzurichten, dass sie alle wünschenswerten
mathematischen Eigenschaften aufweist, die keine Verfälschung
der ökonomischen Aussage herbeiführen.“ (Münnich, 39)
Ganz unverblümt propagiert der
Volkswirt, dass Wissenschaft sich beim Stilisieren keinen Zwang
anzutun braucht. Zwar weiß er nicht, wie die Funktion
ausschaut, aber wünschen tut er sich halt eine lineare
Funktion. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sich eine solche
aus dem Nichts zu erschaffen:
„Naturgemäß kann man ...
jede Funktion ... durch eine Gerade anpassen.“ (Münnich,
39)
Was will er eigentlich
an was anpassen? Ausgerechnet eine Funktion, die er nicht
kennt, also die unbekannte Kurve an seine gewünschte und
deshalb als sinnvoll bezeichnete lineare Funktion:
„wir gelangen somit zur
Gleichung A(t) = a + bY(t).“ (Münnich, 102)
Frisch erfunden und schon
interpretationsbedürftig
Angesichts der Genese dieser
Gleichung ist der Wunsch des Ökonomen sehr verständlich, zu
erklären, was sie nun überhaupt sagen soll.
„Den ersten Summanden a der
rechten Seite der Gleichung bezeichnen wir als die autonomen
Ausgaben, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass dieser Teil
der Ausgaben von der Höhe des Volksein-kommens unabhängig ist.“
(Münnich, 102)
Drollig sind diese autonomen
Ausgaben klein a schon: Herr Münnich vertraut darauf, dass sich
niemand mehr so genau an den Kern seiner Konstruktionsabsicht
erinnert - nämlich dass er A als abhängig von Y darstellen
wollte. Deshalb führt er hier eine autonome Ausgabenkomponente ein -
und sagt selber noch, dass „autonom“ in schlichtem Deutsch
unabhängig bedeutet. Und dieses kleine a soll explizit größer
als 0 sein. Dem Normalverbraucher wird damit zwar das kleine
Kunststück abverlangt, auch noch bei Y = 0, also bei Null Einkommen
munter a DM „autonom“ zu verpulvern. Diesen Unsinn gibt der Ökonom
durchaus zu. Allerdings verweist er diesmal nicht darauf, dass klein
a ökonomisch sinnvoll, sprich in Mutterns Küchenwelt plausibel sei.
Sondern er packt die Sache am genau entgegengesetzten Ende an: Klein
a ist mathematisch notwendig:
„Die Höhe der autonomen
Ausgaben ist daher auch nur eine aus Gründen der Darstellbarkeit
der Geraden erforderliche, rein fiktive Größe.“ (Münnich,
102)
Das ist eine glatte Lüge:
„Darstellbar“ als Gerade wäre natürlich die Funktion A = a + bY für
a = O genauso gut. Dann handelte es sich bloß dummerweise um eine
Gerade, die durch den Nullpunkt (Ursprung) des Koordinatensystems
geht. Und eine solche Gerade will Münnich nun mal nicht haben. (Aus
ähnlichen guten Gründen setzt er einige Einschränkungen über die
Größe von b in die Welt.)
Warum nur?
Wie immer, wenn es in der
Wissenschaft unmotiviert zugeht, sind die höheren Motive schon fast
mit den Händen zu greifen. Münnich hat nämlich noch
eine 2. Gerade in petto und
möchte, dass beide zusammen einen wunderschönen Schnittpunkt
ergeben. Dieser Schnittpunkt
soll genau der Punkt sein, den die Wirtschaft letztendlich annimmt -
wär ja auch blöd, wenn man nur Gleichungen und Geraden hätte, die
nicht gänzlich festlegten, was genau bei der Wirtschaft rauskommt.
Die Gleichung, um die es sich handelt, heißt A = Y. Diese Gleichung
bezeichnet Münnich als „buchhalterisch“,
was besagen soll, dass so
und nur so die
Wirtschaft mit ihren vielen Größen ins Reine kommt. Es kann und darf
nicht sein - will Münnich damit sagen -, dass von dem schönen Y
etwas übrig bleibt oder mehr A zustandekommt, als gewesen ist. In
der Tat: Auch wir können uns nur schwer vorstellen, wo ein
übriggebliebenes Y sich in der Welt aufhalten sollte - oder an
welcher Stelle andererseits ein zuviel ausgegebenes A ein Loch
gerissen hätte. Aber ganz und gar nicht teilen wir die
ideologische Vorstellung,
die hier mit einer Gleichung wissenschaftliche Formen angenommen
hat. Die Vorstellung nämlich, dass die
Wirtschaft ein wohlgeordnetes Gefüge von
Größen, ein ewiger Kreislauf, ein Gleichgewicht sei - oder wie die
ganzen Bilder des Füreinander oder der Harmonie alle heißen mögen.
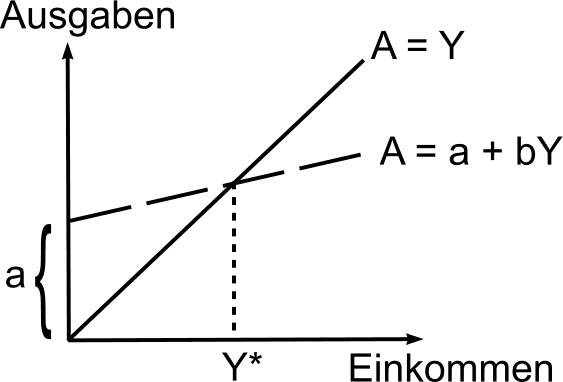
Die Nutzanwendung dieser sog.
Gleichgewichtsbedingung besteht selbst-redend darin, einen
Gleichgewichtspunkt festzulegen - und das geht so:
„Zur Berechnung des
Gleichgewichtseinkommens setzt man Gleichung l in Gleichung 2
ein und erhält Y(t) = a + bY(t), ... eine Bestimmungsgleichung
für die Größe des Gleichgewichtswertes des Volkseinkommens, den
wir als

berechnen.“ (Münnich,
103)
Das Ziel des Ökonomen, seine Idee
eines Gleichgewichtsvolkseinkommens, d.h. eines Punktes, wo die
Wirtschaft in Ordnung geht, mathematisch vorstellbar zu machen, hat
er mittels des Betrugs erreicht, seine Verhaltensgleichung mit den
„Parameterwerten“ a ≠ 0 und 0 <
b < 1 zu präparieren. Ohne diese methodische Vorschrift an
seine eigene Gleichung, die genau diese Werte von sich aus ganz und
gar nicht notwendig macht, wär's Essig gewesen mit dem Schnittpunkt.
Ganz unverfroren nennt er diese seiner Beweisabsicht entsprungenen
Voraussetzungen der Konstruktion des Schnittpunkts eine
„Schlussfolgerung“ (S. l03) aus diesem - als würden sie sich quasi
als mathematisches Gesetz notwendigerweise aus der einmal erfundenen
Gleichung ergeben.
Und betrachtet man rückblickend
noch mal beide Gleichungen gemeinsam, so zeigt sich der allerdickste
Pferdefuß der ganzen Ableitung:
Die sog. buchhalterische Identität
Y = A sollte ausdrücken, dass A nie und nimmer einen anderen
Wert annehmen kann als eben Y. Die andere, die sog.
Verhaltensgleichung, sollte deshalb immer gelten, weil er sie
empirisch gewonnen haben will. Nur: Wenn die Lösung Y* der
einzige Wert ist, der die beiden Gleichungen simultan erfüllt,
so heißt das eben, dass die beiden Gleichungen für alle anderen
Werte nicht miteinander zu vereinbaren sind. Die Werte von Y,
die die Gleichungen, jede für sich genommen, beschreiben, sind also
ideeller Natur. Und wenn die buchhalterische Gleichung A = Y
- laut Definition - immer erfüllt sein muss, kann die andere,
außer bei Y* nie erfüllt sein. Sie ist also der Unsinn einer
„Gesetzmäßigkeit für das Ausgabeverhalten“, das in dieser Form in
der Realität gar nicht vorkommen kann. Und es muss gelogen sein,
dass die Ökonomen den Verlauf der ganzen Geraden - wie sie nicht
müde werden zu beteuern - durch Beobachtung in der Realität gefunden
haben. Deshalb wird in manchen Ökonomiebüchern diese Gerade auch nur
gestrichelt gezeichnet, was ausdrücken soll, dass sie -
übrigens die einzige empirische Gerade - eigentlich gar nicht
da ist. Das ist aber leider sehr fatal. Fatal für den Schnittpunkt.
Es gibt keine Gerade mehr, die ihn bilden könnte, also auch keinen
Schnittpunkt, also auch kein Gleichgewicht.
Fazit:
Herhalten muss die Mathematik,
um die ideologische Botschaft des Ökonomen in die Welt zu bringen:
die Wirtschaft ist ein Mechanismus. Sie besitzt einen
inneren Zusammenhang, der immer aufgeht, und die Leute bringen mit
dem, was sie wollen, genau jenen Zusammenhang hervor - ihr Wille
passt zum Mechanismus wie die Faust aufs Auge. Ihre
Entscheidungsfreiheit ist mit der Notwendigkeit in Übereinstimmung,
lautet die Moral des Gleichungssystems. Diese verkehrten Ideen des
Volkswirts erhalten dadurch Glaubwürdigkeit, dass er sie
mathematisch fasst: Eine Welt, in der das Zusammenwirken
gegensätzlicher Zwecke erzwungen wird, soll durch die Erfindung
seiner mathematischen Gesetzmäßigkeiten als Sachgesetz und
mathematisch wohlgeordnet denkbar sein. Die Berechenbarkeit soll der
Welt der Wirtschaft die unwidersprechliche Vernunft verleihen und
sie darin als ebenso unanfechtbar wie die Natur darstellen, deren
Gesetze tatsächlich unabhängig vom Wollen Objektivität und
mathematische Gestalt haben.
Beispiel 3: Der
mikroökonomische Optimierungsgedanke oder: Jedes Wirtschaftssubjekt
berechnet immer sein Bestes
Bei allem, was der Mensch so tut
und treibt - Versicherungspolicen kaufen, Geige spielen oder einfach
einen Nagel in die Wand schlagen -, kann er seine Sache gut oder
schlecht machen. Das Prädikat „gut“ verdient er, wenn er das, was
die jeweilige Tätigkeit ausmacht, richtig hinkriegt. Das Prädikat
„schlecht“ verdient er, wenn er den Anforderungen seines Tuns nicht
gehörig nachkommt. Das kann an äußeren Hindernissen, an Unvermögen
oder an Voreingenommenheit durch andere Zwecke liegen. Aber egal.
Was gut ist und was schlecht, bemisst sich jedenfalls an der
auszuführenden Tätigkeit; „gut“ fällt völlig damit zusammen, dass
sie ihrer Bestimmung gemäß und ungestört ausgeführt wird. Man nimmt
sich deshalb auch nicht vor, erstens einen Nagel in die Wand zu
schlagen und zweitens dies möglichst gut zu tun. Der eine Vorsatz
reicht völlig aus, in ihm ist alles enthalten.
Die Mikroökonomie behauptet nun,
das Verhalten der Wirtschaftssubjekte sei damit zu erklären, dass
sie ihre Sache möglichst gut machen wollen: Was auch immer sie tun,
sie optimieren, wie der wissenschaftliche Ausdruck lautet.
Und aus diesem Prinzip soll sich ein Verständnis der jeweiligen
Tätigkeit insgesamt ergeben.
Falsch ist dieser
Optimierungsgedanke, weil er etwas zum allgemeinen Inhalt
wirtschaftlicher Tätigkeit macht, was, wie wir gesehen haben,
überhaupt keine Inhaltsbestimmung von irgend etwas auf der
Welt sein kann. Was die einzelnen Tätigkeiten ausmacht - arbeiten
gehen, Aktien kaufen etc. -, wird so ganz einfach unterstellt; ihre
Spezifik wird keiner Bestimmung und weiteren Erklärung für würdig
befunden. Umgekehrt sollen sich diese ökonomischen Tätigkeiten als
Beispiele, Sonderfälle und Einkleidungen aus dem in dieser
Abstraktheit widersinnigen und inhaltsleeren Tun begreifen lassen,
das darin besteht, es gut zu machen.
Um seine falsche Abstraktion, also
das „gut“-machen als selbständige Tätigkeit, in einen
wissenschaftlichen Gegenstand umzumünzen, beruft sich der
Mikroökonom auf die Mathematik, und zwar denkt er insbesondere an
die folgende Abteilung: Die Mathematik besitzt Verfahren, sogenannte
Extremwerte, also Maxima, Minima, von Funktionen auszurechnen.
Jeder, der eine höhere Schule
besucht hat, kennt die Grundzüge dieser Technik unter dem Stichwort
„Kurvendiskussion“, und er hat sie sicher auch schon angewendet
gesehen. Beispielsweise, um in der Physik bei Wurfparabeln den
höchsten Punkt oder den Winkel größter Reichweite auszurechnen.
Bloß: Wenn die Mathematik so ganz allgemein von Extremwertaufgaben
und Techniken ihrer Lösung handelt, dann ist das noch lange nicht
die falsche Abstraktion der Optimierung, auf die die Ökonomen
hinauswollen. Genauso wie zum Rechnen mit seinen Regeln und
Techniken Zahlen gehören, so gehören zur Kurvendiskussion
ordentliche Kurven bzw. die sie beschreibenden Funktionen. Das sind
die Gegenstände der Mathematik, abstrakte, aber genau bestimmte
Dinge, und sie haben mit der Vorstellung eines „es möglichst gut
machen wollen“ nichts gemein.
Um nun die Sache der Mathematik
als die eigene auszugeben, behauptet der Mikroökonom als nächstes,
dass die von ihm betrachteten Wirtschafts-tätigkeiten darin
bestünden, für eine variable Größe - die sogenannte Zielfunktion -
ein Maximum zu finden. Egal, ob Arbeiten, Einkaufen, Geld anlegen -
dass hier lauter Extremwertaufgaben vorliegen, verkündet die
Ökonomie als hochwissenschaftlichen Aspekt der Sache.
Wie dumm diese Behauptung ist,
sieht man vielleicht am besten am Beispiel einer
Wirtschaftstätigkeit, die tatsächlich ein quantitatives Kriterium
für gutes bzw. schlechtes Gelingen hat. Wenn einer an der Börse
spekuliert, will er einen Gewinn, einen Überschuss in Geld machen.
Und Geld als Zweck hat es nun mal an sich, dass man nie genug davon
kriegen kann. Die Vorstellung, dass so ein Spekulant - oder ein
Kapitalist überhaupt - nach einem Gewinnmaximum strebt, ist aber
eben deshalb grundfalsch: Maßlosigkeit ist das Prinzip
der Profitmacherei, und nicht Streben nach einem maximalen
Gewinn. Und sowenig er vorhat, eine ganz bestimmte Gewinnhöhe
anzusteuern, sowenig hat er auch eine Funktion oder Kurve, die
diesen „richtigen“ Punkt zu ermitteln gestattete. Schließlich heißt
die Sache „Spekulation“ und nicht „Ausrechnen“, wo es um Kauf und
Verkauf der richtigen Papiere zum richtigen Zeitpunkt geht. Hat da
der Verlierer vielleicht vergessen, dass er optimieren wollte? Oder
hat er in der Lotterie des Schicksals die falsche Kurve verpasst
gekriegt?
Lieber einen Mercedes als noch
einen BMW
Die Fortsetzung der Theorie
besteht deshalb notwendigerweise in der Neuschöpfung ihrer
Gegenstände:
„Die von den betrachteten
Wirtschaftssubjekten in der Realität verfolgten Ziele sind nur
Schwer zu fassen und nicht eindeutig formulierbar ... Man kann
allgemein von der Sorge um das Wohlergehen der
Familienmitglieder und somit davon ausgehen, dass der Haushalt
jeweils das ihm am günstigsten erscheinende Gütersortiment
auswählen wird, das er mit dem zur Verfügung stehenden Budget
kaufen kann ... In der älteren Literatur wurde statt der Annahme
der Wahl des bestmöglichen Gütersortiments das Ziel der
Maximierung des Nutzens--im Sinne eines Maximums an erreichter
Bedürfnisbefriedigung-- formuliert. Theoretiker wie Gossen ...
strebten an, den Nutzen der Haushalte in bestimmten
Nutzeneinheiten zu messen ... Deshalb spricht man bei diesem
Ansatz von einer kardinalen Nutzengröße. Diese Bestrebungen
haben nicht den erhofften Erfolg gezeitigt; man hat allgemein in
der Haushaltstheorie zurückgesteckt und beschränkt sich darauf,
Nutzenvergleiche anzustellen ... Man hat sich auf ein ordinales
Nutzenkonzept zurückgezogen, behält jedoch weiterhin dass Ziel
der Maximierung des Nutzens bei, wiewohl dieser nicht in
absoluten Größen gemessen wird ... Am Ergebnis der Analyse
ändert sich dadurch gegenüber den traditionellen Ansätzen nicht."
(Böventer, 11-12)
Natürlich sind die Ziele der
Wirtschaftssubjekte überhaupt nicht schwer zu fassen. Die Leute
werden schon wissen, was sie wollen, und der Ökonom bräuchte sie
z.B. nur zu befragen. Und natürlich weiß er auch ohne diese Mühe
schon, wie die Antworten aussehen würden - aber eben dies stört ihn:
„in der Realität“ gibt's mannigfache Zwecke und Bedürfnisse, aber
weit und breit keine „eindeutige“ Zielfunktion. Diese richtig zu
„formulieren“, ist deshalb die Aufgabe der Wissenschaft.
Für den „Haushalt“ - die
Ökonomen-Stilisierung der einkaufenden und konsumierenden Menschheit
- heißt die einzuführende Größe „Nutzen“. Natürlich unterscheidet
ein Konsument in der Vielzahl der nützlichen Dinge, was seinen
speziellen Bedürfnissen dient und was nicht, oder was ihm dann im
Einzelfall besser oder schlechter gefällt. Und die Schranken seines
Geldbeutels zwingen ihn laufend dazu, beim Einkaufen auf den einen
durchaus gewünschten Gegenstand zu verzichten, damit er sich den
anderen leisten kann. Aber weder die Unterschiede, die das Bedürfnis
macht, noch der Verzicht, den das liebe Geld einem aufnötigt, lassen
sich durch eine Größe namens „Nutzen“ erklären, die mehr oder
weniger vorhanden sein soll. Was sollte das denn auch heißen, dass
ein Auto mir mehr Nutzen brächte als eine Reise nach Teneriffa?
Entweder ich will gar nicht dorthin. Oder ich hätte gerne beides,
aber muss mich aus Geldgründen zwischen diesen so gar nicht
vergleichbaren Dingen entscheiden. Da mag ich dann sogar Gründe
haben, das Auto zu wählen (und in der Regel sind solche Gründe
wiederum aus der Not geboren, also dass ich z.B. das Auto für meine
täglichen Verpflichtungen brauche). Aber ganz gewiss lasse ich das
eine Bedürfnis nicht deshalb unbefriedigt, weil mir das andere ein
„Mehr an Befriedigung“ verschafft. Schließlich ist Hunger auch nicht
schlimmer als Durst und umgekehrt.
Die Modernisierung der
Nutzentheorie: ein Optimum von nichts Bestimmtem
Diese idiotische Vorstellung von
miteinander vergleichbaren Nutzenmengen bzw. Graden der
Befriedigung, die ganz verschiedene Konsumartikel gewähren, ist
absolut notwendig, aber auch völlig ausreichend für die Verwandlung
des Einkaufens in ein Optimierungsproblem. Nichtsdestotrotz haben
die Ökonomen beschlossen, diesen ihren zentralen Fehler noch zu
verbessern. Zum Beispiel haben sich einige daran gestört, dass der
Nutzen, weil er nicht existiert, auch nicht überzeugend gemessen
werden kann. Zwar teilt der Nutzen dieses Schicksal mit sämtlichen
Größen der VWL (siehe Sozialprodukt) aber diesmal sind die Ökonomen
auf den Spleen verfallen, ihr Programm unter ausdrücklichem Verzicht
auf ein Maß des Nutzens durchziehen zu wollen. Die Grundidee ist die
folgende: Man kann eine Gruppe von Leuten sich nach ihrer Größe
aufstellen lassen. Man kann diese Leute aber auch in alphabetischer
Reihenfolge aufstellen lassen. In beiden Fällen kann man dann den
ersten in der Reihe vortreten lassen. Und diese Tatsache, dass eine
lineare Ordnung auch ohne Größenvergleich, sondern eben nach einem
anderen Prinzip herstellbar ist, hat Ökonomen zu dem Einfall
beflügelt, ihr Optimierungsprogramm ohne Nutzengrößen und deren
Vergleich durchzuziehen: Nutzenmaximierung sei hinfort so
verstanden, dass die oberste Position in einer Rangordnung der Güter
gewählt wird.
Die Frage, wie ein Konsument diese
Rangordnung herstellen soll, wollen wir lieber nicht stellen. Die
VWL hält sich für einen Ausbund an wissenschaftlicher Redlichkeit,
wenn sie darüber keine Annahmen macht. Aber dass diese Rangordnung
in jedermanns Hirnkasten existiert, das möchte sie in ihrer
wissenschaftlichen Redlichkeit schon annehmen.
Für weit verdienstvoller hält sie
dann die Frage, wie man denn nun von der Vorstellung einer
Rangordnung den Weg zurück zu den bewährten Kurvendiskussionen der
Mathematik findet, auf die man es ja eigentlich abgesehen hat.
Wir rufen sicher kein Erstaunen
hervor, wenn wir hier zusammenfassend mitteilen, dass dieser Weg mit
geistigen Klimmzügen gepflastert ist, dass er von Studenten der
Mikroökonomie kaum jemals komplett verstanden wird und dass selbst
namhafte Lehrbuchautoren daran scheitern, ihn ihren eigenen
Qualitätsmaßstäben entsprechend darzustellen. (z.B. Böventer S. 6l:
„Das Konzept stetiger Präferenzen ist nicht
ganz einfach, und wir werden deshalb nicht eine allgemeine und
formal präzise Definition dieses Begriffs entwickeln ...“)
Und natürlich handelt es sich um lauter Fehler. Der wichtigste sei
hier mitgeteilt: Wenn wir in unserem Beispiel die Leute in
alphabetischer Reihenfolge antreten lassen, können wir ihnen
anschließend auch Platzziffern verpassen: Amalie = l, Anselm = 2,
Anton = 3 usw. usf. Heureka, schreit der Ökonom, wir sind zurück auf
quantitativem Gebiet!
Bloß: Solche Platzziffern sind nur
eine alternative Manier, die betrachtete Rangordnung auszudrücken
oder festzuhalten. Man benutzt den Umstand, dass die Zahlen
auch eine Ordnung haben,
man stellt gewissermaßen einen Vergleich
an. Aber deswegen kann man sich noch lange nicht alle Qualitäten der
Zahlen zueigen machen. Zahlen geben ein Mehr oder Weniger an aber
was sollte es heißen, dass Anselm mehr ist als Amalie und Anton noch
mehr? Und mit Zahlen kann man rechnen - aber was sollte es heißen,
dass der Anselm zweimal die Amalie ist usw.?
Diesen Unterschied gibt der Ökonom
mit seiner protzigen Differenzierung zwischen „kardinalen“ und
„ordinalen“ Größen selber zu - aber nur soweit er scharf drauf ist,
das leidige Problem mit der Nutzenmessung zu umgehen. Und kaum hat
er für den wissenschaftsstrategischen Vorteil bloß „ordinaler“
Größen genügend Reklame gemacht, vergisst er ganz einfach den eben
noch so wichtigen Unterschied und behandelt seine Platzziffern wie
stinknormale kardinale Größen. Dieses Unterscheiden und
anschließende Vergessen ist das Geheimnis des letzten Satzes im
Zitat: „Am Ergebnis der Analyse ändert sich dadurch gegenüber den
traditionellen Ansätzen nichts.“
Also: Erst soll man glauben, dass
die Konsumenten den Gütern keineswegs einen „Nutzen“ verschiedener
Größe verpassen, sondern nur Indizes oder Platzziffern gemäß einer
Rangordnung - und dann soll man auf einmal glauben, dass es eine
stetige, differenzierbare und mit sonstigen mathematischen
Annehmlichkeiten ausgestattete „Nutzenfunktion“ gibt die die Größe
des Nutzens aus den Quanta der betrachteten Güter zu berechnen
gestattet.
Also erst soll der Konsument bloß
eine Einkaufstüte mit 20 Zigaretten und zwei Pfund Haferflocken
besser finden als eine Einkaufstüte mit 100 Zigaretten und einem
Pfund Haferflocken. Aber dann soll er auf einmal eine Funktion
(Beispiel Böventer S. 89) u = x1 x2 haben,
wobei u = der Nutzen, x1 = die Zigaretten und x2
= die Haferflocken sein sollen. Dass sich jetzt natürlich
wunderschöne Extremwertaufgaben stellen und lösen lassen, glauben
wir ja gerne. Aber dass sich diese wissenschaftliche Leistung einem
Beschiss verdankt, ist selbst im Resultat noch überdeutlich:
einerseits soll der Nutzen eine Zahl sein, bei der man sich nichts
denken dürfen soll; andererseits aber hat der Nutzen jetzt auf
einmal eine Dimension gekriegt, nämlich Stück Zigaretten mal Pfund
Haferflocken, ist also eine sehr substanzielle, wenn auch nicht
unbedingt schmackhafte Sache geworden. Und was ist, wenn unser
Konsument seine Nutzenfunktion zum neuen Jahr auf u = x1
x22 geändert hat? Dann ist Nutzen auf einmal
Zigaretten mal Haferflocken im Quadrat und somit eine ganz andere
Sache als im Jahr zuvor!
Die Wissenschaft hat
festgestellt: Alles bestens auf der Welt!
An den theoretischen Anstrengungen
der Mikroökonomie ist der Anspruch unübersehbar, dass man doch
ausrechnen können müsse, was die Wirtschaftssubjekte tun und
treiben. Wenn aber jetzt, um beim Beispiel Haushalt zu bleiben, der
Käufer aus dem Supermarkt tritt, weiß dann die Mikroökonomie, was in
seiner Plastiktüte ist? Mitnichten. Denn die von der Theorie mit
soviel Mühe erschlossenen Rechenmethoden funktionieren nur, wenn die
eingangs postulierte Nutzenfunktion bekannt ist. Und das wird noch
nicht einmal der größte Angeber unter den Ökonomen behaupten.
Also reduziert sich der ganze
Formelkram, der doch eigentlich zum Rechnen da ist, auf einen
Kommentar zum Weltgeschehen. Den Kommentar nämlich, dass der
Käufer ganz gewiss das innerhalb seiner finanziellen Schranken für
ihn günstigste Warensortiment erworben hat.
Einerseits ist dieser Kommentar
die albernste Tautologie, die man sich vorstellen kann. Denn
natürlich kauft sich keiner Rothändle statt Marlboro, wenn er lieber
Marlboro hätte.
Das ist genauso eine
Schlaumeierei, wie wenn ein Meteorologe nicht eine Wetterprognose
abgeben, sondern sich auf die Auskunft beschränken würde, es käme
immer das Wetter, das sich „durchsetzt“.
Andererseits wird mit dieser
Pseudo-Bescheidwisserei für eine
Interpretation des Kaufens gesorgt, die es
in sich hat. Denn beim Einkaufen ist man mit der Tatsache
konfrontiert, dass die Gegenstände des Bedürfnisses zwar die
Kaufhäuser füllen, aber keineswegs für einen selbst bestimmt sind.
Als Waren haben die nützlichen Dinge die Bestimmung, ihrem Besitzer
Geld einzubringen. Der Kapitalismus produziert massenhaft Reichtum
und trennt ihn von den bedürftigen Individuen. Das mag man einen
Widerspruch nennen oder einfach Scheiße. Aber die Ökonomie
verwandelt dies höchst ungemütliche und keineswegs notwendige
Verhältnis (es wird ja genug produziert) in ein ewiges
Menschheitsproblem, das darin beistehen soll, aus jeweils
beschränkten Gegebenheiten das Beste zu machen. Und so gesehen
geht eine Welt voll Armut und Gewalt schon ziemlich in Ordnung.
Beweisbar ist diese
apologetische Interpretation natürlich nicht. An die Stelle
eines Beweises aber tritt jetzt die Vorschrift, dass sich solche
Weltanschauung nach allen selbstgesetzten Regeln und Schikanen der
Wissenschaft durchführen läßt.
Solche Theoretiker fragen sich
nicht, was der Kauf von Waren ist, sondern wie sich die vorgefasste
gute Meinung davon, der Optimierungsgedanke, immer exakter ausbauen
lässt. Deshalb lassen sie sich erst einen ganz exakten Nutzen
einfallen. Deshalb sind sie so frei, diese Nutzenfunktion als
nächstes durch abstrakte Ordnungen und Hierarchien noch viel exakter
zu untermauern. Und deshalb sind diese Brüder auch so scharf auf
Mathematik.
Zahlen, Funktionen und Gleichungen
sind nicht nur die Insignien und Schaustücke der Gelehrsamkeit,
sondern in der Tat auch die adäquaten Ausdrucksmittel der
Botschaften, auf die Ökonomen scharf sind: lauter Sachgesetze und
Notwendigkeiten, lauter Berechnungsmöglichkeiten und Gleichungen,
die aufgehen - mit einem Wort, die Welt des Klassen-gegensatzes und
der Konkurrenz geht in Ordnung.
Verwendete Literatur
Henrichsmeyer, Einführung in
die Volkswirtschaftslehre, Stuttgart l978
Böventer, Einführung in die
Mikroökonomie, 4. Aufl., München l985
Münnich, Einführung in die
empirische Makroökonomik, Berlin l982
Bartling, H.; Luzius, Grundzüge
der Volkswirtschaftslehre, 4. Aufl., München l983
Stobbe, Volkswirtschaftslehre
1, Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, 4. Aufl., Berlin l976
|